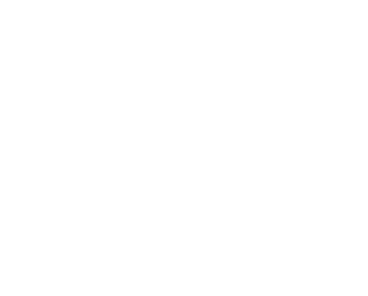Ich glaube – hilf meinem Unglauben
In der Geschichte aus dem Markusevangelium hat der Satz, der wie ein stiller Seufzer klingt, eine ganz andere Tonalität. Sie ist laut, aggressiv, verzweifelt. Mit wenigen Worten zeichnet Markus eine dramatische Szene: Wir befinden uns mitten in einem Getümmel – Schriftgelehrte, die Vertrauten Jesu, eine Menschenmenge. Die Emotionen kochen hoch. Ein Wort gibt das andere. Im Zentrum ein Vater mit seinem sicher verschreckten, schwer behinderten Jungen. Er soll besessen sein. Stadtbekannt seine Anfälle mit Schaum vorm Mund, Zähneknirschen, Krampfanfällen, Ohnmacht. Ein böser Geist ist am Werk. Kinder wie dieses leben mit ihren Familien in sozialer Isolation.
Vermutlich gab es darum schon helle Aufregung, als Vater und Kind nur auftauchten unter den Leuten. Mich beeindruckt dieser Mann. Er begeht einen Tabu-Bruch: Mit unreinen Geistern spaßte man nicht. Sie galten als gefährlich. Ansteckend womöglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen das hinnahmen. Vielleicht akzeptierten sie noch, dass er zu diesem Heiler und Lehrer wollte, über den alle Welt sprach. Ganz bestimmt aber eskalierte der Streit spätestens, als die Jünger zu heilen versuchten, und es nicht konnten.
Was für eine Szene, großes Kino: Der verzweifelte Vater, sein verängstigtes Kind, die spottenden, schreienden Menschen, die sich rechtfertigenden Jünger. Und dann: Auftritt Jesu. Ich kürze ab: Der Heiland ist unfreundlich, wirkt genervt – man weiß nicht recht, von wem, verlangt schroff nach dem Kind, lässt sich die Krankengeschichte erzählen. Der Vater fleht ihn an: Wenn du etwas kannst, dann erbarme dich… – Jesus knurrt: „Alles ist möglich, dem der da glaubt.“ Und – vielleicht ist das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt – der Vater explodiert. Keine Spur von Selbstkontrolle. Er ist außer sich, er schreit: „Ich glaube. Hilf meinen Unglauben“. So dichtet Markus. Ob er überhaupt weiß, was er gerade gesagt hat, dieser Mann?
Was sich in der Jahreslosung wie ein stilles Gebet liest, hat eine so ganz andere Temperatur. Es ist ein Schrei. Und die Worte, das verzweifelte Vertrauen, das aus diesem Schrei gepresst wird, sind nicht Ergebnis einer wohltemperierten theologischen Einsicht. Das Studium heiliger Schriften kommt gar nicht vor. Dieser Glauben hat keine Alternative mehr. Er ist erlitten. Dieser Schrei wurzelt im ganzen bisherigen Leben dieses Vaters. „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ spitzt das Leid zu, und wendet es wie eine Waffe gegen das unerträgliche Schicksal des Kindes und seiner ganzen Familie. „Wenn du kannst, dann erbarme dich.“
Das ganze bisherige Leben dieses Vaters: das ist die Liebe zu seinem kranken, vielleicht schlimmer noch: besessenen Kind. Die Verweigerung, die Hoffnung zu verlieren. Der Mut, sich über gesellschaftliche Konventionen hinwegzusetzen und keine Peinlichkeit zu scheuen. Die Hartnäckigkeit, die sich nicht Abwimmeln lässt. Der Trotz gegen die Enttäuschung, die nicht das letzte Wort haben soll.
Was brauchen Menschen im Jahr 2020? Sie brauchen mehr von der Leidenschaft dieses verzweifelten Vaters. Von dem Wissen, dass das Erlittene zu einer Kraft werden kann, die zum Heil führen wird. Wo begegnen wir Menschen, die sich Liebe, Hoffnung, Mut und Hartnäckigkeit nicht austreiben lassen? Die nicht einknicken vor den bösen Geistern, die was und wen wir lieben, kaputt machen? Die das Vertrauen nicht verlieren wollen, auch wenn alles dagegen spricht? Die ihren Unglauben so ernst nehmen, wie ihren Glauben? Wo diese Leidenschaft ausbricht, wo das Vertrauen lebendig ist, können Gottes Wunder geschehen, kann Jesus heilen. Das wünsche ich uns.
Euer Detlef